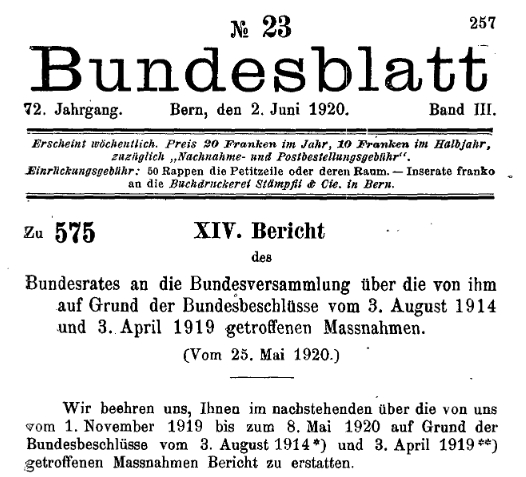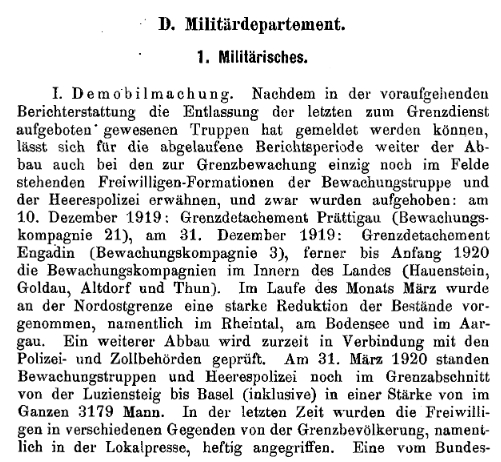Auf nach Schuders.
Mit der Rhätischen Bahn fährt man von Landquart durch die wildromantische Klus ins Prättigau. Die Ausläufer der Rhätikon- und der Hochwangkette, die das liebliche Wiesental einschliessen, treten hier so enge zusammen, dass kaum Raum bleibt für Strasse, Eisenbahn und Fluss. Zu beiden Seiten erheben sich schroffe Felswände; mächtige Pallisaden stehen da zum Schutze der Verkehrsmittel. Ernst und düster schauen von schwindelnder Höhe riesige Wettertannen herunter ins Tal und lauschen dem Gurgeln der schäumenden Landquart und dem Pusten des schnaubenden Dampfrosses. Hoch oben am Fusse einer Felswand erblicken wir die Ruinen der alten Feste Fragstein, stumme und doch vielsagende Zeugen alter Zwingherrschaft.
Bald sind wir in Pardisla. Hier weitet sich das Tal. Auf unserer rechten Seite, links der Landquart, öffnet sich das Nebentälchen Valzeina, ein stiller Kurort mit neuer, schön angelegter Strasse und Telephonverbindung. Links, auf hoher Terrasse am Fusse des Vilan, liegt Seewis, ebenfalls Kurort, die Heimat des Dichters Johann Gaudenz von Salis.
Wir kommen nach Grüsch. Alte Junkerhäuser verleihen der gewerbreichen Ortschaft ein stattliches Aussehen. Von einem Hügel herunter grüssen die Überreste der Burg Solavers, der Geburtsstätte des letzten Grafen von Toggenburg.
Durch einen breiten, der Landquart abgewonnenen Wiesenplan gelangen wir nach Schiers. Hier steigen wir aus. Vom Bahnhof aus erblickt man in der Richtung des Schraubachtobels die kühnen Wände der Sulzfluh und der Drusenfluh. In Schiers besteht seit 1837 eine von zirka zweihundert Schülern besuchte Lehranstalt, bestehend aus Realschule, Techn. Abteilung, Seminar und Gymnasium.
In Schiers wird noch ein Imbiss genommen und dann geht’s den Berg hinan. Der Weg ist zurzeit recht holperig und kostet manchen Schweisstropfen. Wenn wir wacker ausschreiten, werden wir jedoch in zwei Stunden das 600 Meter höher gelegene Bergdörfchen Schuders erreichen.
Nun kommen wir in ziemlich horizontaler Richtung nach Busserein, einer zweiten zu Schiers gehörigen Fraktion. Ein Teil dieser Gegend wurde vor zirka 100 Jahren durch einen Erdrutsch arg heimgesucht. Es war in den Jahren 1798 – 1803. Unterhalb Spinas, am sogenannten Spitzlig, brach die Rüfe los und bewegte sich bald schneller, bald langsamer, je nach Jahreszeit und Terrain. Bisweilen vermochte sie in einem Tag nur einen Stecken zu „helten” (umdrücken), bisweilen rückte sie ein „Heumäss” (sieben Fuss) weit. Zu andern Zeiten und an anderem Ort blieb sie manchmal ganz stehen, oder fuhr auch bedeutend rascher, so dass die „Wäslig” (Rasenstücke) von den Knaben als Fahrzeug benutzt werden konnten. Zwei Häuser mussten abgebrochen und anderswo aufgebaut werden; ein Stall wurde fortgerissen und viel Boden verwüstet. Eine Frau, welche einmal die Schuttmasse passieren wollte, blieb im Moraste stecken und konnte nur mit Mühe herausgezogen werden. Die Entstehung dieser Runse soll durch ein Erdbeben erfolgt sein; unserer Ansicht nach aber dürfte sie ganz auf die Einwirkung des Wassers zurückzuführen sein.
Wir schreiten abwärts zum sogenannten Crestabrückli; die Hälfte des Weges liegt hinter uns. Nach kurzer Rast geht’s in vielen Kehren die steile Cresta hinauf. Der oberste Teil derselben heisst „Kellertolla”. Von hier geht der Weg wieder ziemlich horizontal durch die sogenannten Kirchenstauden bis zur Pleisrüfe. Diese Rüfe brach in den Jahren 1867 und 1868 los, riss ein grosses Stück Buchenwald in die Tiefe, gefährdete einige Häuser, welche geräumt und abgebrochen wurden, und beschädigte schöne Wiesen in weitem Umkreis. Bald nachdem wir diese Runse passiert haben, erblicken wir vor uns die ersten Häuser von Schuders und die kleine Bergkapelle. Auf einem einladenden Holzhäuschen flattert eine Fahne und winkt ein Schild mit der Aufschrift „Gasthaus zum Schweizertor”. Wir sind etwas müde und unser Magen knurrt, also denn hinein ins „Schweizertor”.
Im Bergwirtshaus werden wir von dienstbaren Geistern, den zwei Töchtern des Hauses, freundlich empfangen. Noch sind keine Gäste da, die Saison beginnt erst. Wir lassen uns an einem Tische nieder und bestellen eine Portion Bindenfleisch mit einem Halben Veltliner. Nachdem wir uns gestärkt haben, treten wir wieder ins Freie. Welch herrliche, durchsichtige Luft! In greifbarer Nähe erheben sich vor uns die imposanten Kalkwände der Sulzfluh und Drusenfluh, vergoldet von der untergehenden Junisonne. Berg reiht sich an Berg. Merkwürdig klar heben sich die Spitzen und Kämme vom Horizonte ab. Doch die Dämmerung sinkt aufs Schweizerland, und wir begeben uns ins Haus. Das Nachtessen ist bereit und schmeckt vorzüglich, ebenso der prickelnde Veltliner.
Bald erscheinen einige Männer des Dorfes, bärtige Kraftgestalten, zum Abendhengert. Morgen ist Sonntag; da sitzt man heute abend noch ein Stündlein gemütlich beisammen und plaudert. Einer erzählt „vom alten Joos”, ein anderer vom „Ausbruch der Pest”, ein dritter vom „Kampf mit Wildlütli”, andere vom „Hexentanz”, von der „Nachtschaar”, vom „geheimnisvollen Buch” u.s.w.
Der alte Joos.
Der „alte Joos” ist nicht mehr unter uns. Am Neujahrstag 1901 haben wir ihn in Schuders begraben. Viele haben ihn gekannt und hören gerne von ihm erzählen, denn er war ein durch und durch origineller Mann. Und er verdient es, dass seiner gedacht werde, denn er war auch ein braver, guter Mann.
Seine ganze Lebenszeit, volle 88 Jahre, brachte er in seiner Heimatgemeinde, dem Bergdörfchen Schuders, zu. Um zuerst von seinen körperlichen Eigenschaften zu reden, so erfreute er sich einer fast ununterbrochenen Gesundheit und ausdauernden Rüstigkeit. Er war eine Kraftnatur, einem Geschlecht von Riesen entstammt, die fast alle ein hohes Alter erreichten (mehr als ein halbes Dutzend Personen seiner nächsten Verwandtschaft sind über 80 Jahre alt geworden). Von seinem Vater weiss man, dass, wenn er nach damaliger Sitte mit Butter nach Maienfeld ging, um sie gegen andere Lebensmittel umzutauschen, er nie weniger als 100 alte Krinnen, also ungefähr 1 ½ Zentner, mitnahm, und dementsprechend war auch wieder die Last auf dem Heimweg; einmal brachte er 22 Quartanen an Mehl etc. auf seinen Schultern von Maienfeld nach Schuders! Es konnte vorkommen, dass er, eine Lägel (50 Mass) Wein in einem Tuch an der Achsel, eine Herde Schafe nach Schuders trieb, wobei es bekanntlich manchen Seitensprung zu tun gibt. Noch im hohen Greisenalter, als er an einem Stecken gehen musste, sah man ihn einen grossen mit Schweinetrank gefüllten Eimer ohne Tragreif, bloss mit der einen Hand am Rande gefasst, ein gutes Stück weit zum Stalle tragen. Ein solcher Recke war der Vater, dessen Gebeine, als sie vor etwa 10 Jahren wieder zu Tage traten, an ihrer ungewöhnlichen Grösse sofort erkannt wurden. Von den Söhnen war Hans, der stärkste, vor etwa 15 Jahren ebenfalls als ein hoher Achtziger im St. Gallischen gestorben. Aber auch unser Joos hatte ein gut Teil der väterlichen Kraft geerbt. Auch er schritt manchmal mit einer Lägel Wein beladen von Schiers den beschwerlichen zweistündigen Weg hinauf. Einmal liess er sich sogar, die Lägel Wein am Kopf, mitten in der stotzigen Cresta bereden, ein Morra-Spiel mitzumachen, und gewann dabei eine Halbe Wein. Noch als Achtzigjähriger trug er einen Salzsack voll grüner Birnen von Fanas bis nach Schuders, ohne ein einziges Mal abzustellen, und von Müdigkeit wollte er noch bei seiner Ankunft daheim nichts wissen. Und dass man einst, nachdem er bis in den Rhein hinunter flössen geholfen, in Malans das Geld zur Auszahlung der Arbeiter, 4000 Fl. in lauter Halbgulden, in einem Habersack ihm bis Schiers zu tragen gegeben, erzählte er noch in den letzten Tagen als ein Beispiel des Zutrauens, das er genoss. Seine Stimme war von so weitreichender Mächtigkeit, dass er den Leuten auf Salfsch, um sich oder andern einen Weg von drei Viertelstunden zu ersparen, über das tiefe und breite Schrautobel hinüber Botschaften völlig verständlich zurufen konnte.
Dieser Körperkraft entsprach auch eine seltene Widerstandsfähigkeit. Es machte ihm nichts aus, wochenlang nur von kalten Speisen zu leben und in den nassen Kleidern zu liegen, wie er sie aus Regen oder Schnee heimgebracht. Bei grimmigster Kälte sah man Joos Thöny nicht bloss stets in gewöhnlicher Kleidung, sondern sogar mit offenstehender Hemdbrust, wobei ihm freilich sein dichter Naturpelz zu statten kam. Vor einigen Jahren machte er eine ernstliche Rippfellentzündung durch, ohne auch nur einen Tag das Füttern des Viehes auszusetzen – zum Erstaunen des Arztes, dem die Krankheitserscheinungen gemeldet wurden. In gewissen Dingen trug er dann wieder Sorge für seine Gesundheit. Nie nahm er in die Hitze hinein einen kalten Trunk, nie übereilte oder überanstrengte er sich bei einer Arbeit. Auf diese Weise erhielt er sich seine ungeschwächte Gesundheit und Kraft bis ins höchste Alter, so dass er bis vor wenigen Jahren seine Landwirtschaft selbst besorgen konnte. Es sind nämlich jetzt 4 Jahre, dass er am Neujahrstag abends, infolge einer mit der Zeit eingetretenen Augenschwäche, sich im Schrautobel hinter Schiers verirrte, im Begriff, sich für den folgenden Markttag nach Schiers zu begeben. Die ganze kalte Nacht brachte er im Tobel zu. Dort trafen ihn am Morgen die Holzfuhrleute, welche ihn ins Dorf führten; Schuhe und Strümpfe waren steif gefroren. Nachdem er trotzdem seine Marktgeschäfte abgetan, blieb er für ein paar Tage zur Erholung bei Verwandten, weil ihm doch von dem nächtlichen Abenteuer her «nid grad so guet» war. Eine Woche später befand er sich wieder daheim, ohne irgendwelche weitere Folgen zu verspüren. Doch liess er sich jetzt dazu bewegen, namentlich mit Rücksicht auf seine Sehschwäche, in den Ruhestand zu treten.
Nun aber zu seinen geistigen Eigenschaften. Er hatte sozusagen keine Schulbildung genossen. Gedrucktes lesen hatte er zur Not gelernt, aber Geschriebenes lesen oder selber schreiben hat er seiner Lebtage nicht gekonnt. Dennoch hat er mehr als 30 Jahre hindurch als „Gemeindevogt” die allerdings, bei der kleinen Gemeinde, einfache Verwaltung der Stiftungen etc. geführt. (Nebenbei gesagt, versah er auch an die 50 Jahre das Messmeramt). Und er war ein guter, gewissenhafter und pünktlicher Verwalter. Die schriftliche Rechnungsführung besorgten ihm auf seine Angaben hin, auf die man sich unbedingt verlassen konnte, jüngere Anverwandte. Ein Rechner war er übrigens aus dem ff; mehr als einmal löste er Aufgaben, die vom Schulinspektor so nebenbei probeweise gestellt worden und die weder in der Schule noch sonst jemand herausbrachte, flink und richtig, wusste aber nie zu sagen, wie er es gemacht. Was ihm aber in Haus- und Amtsverwaltung besonders wohl kam, war ein ausserordentliches, ja beinahe untrügliches Gedächtnis, das Altes und Neues unverlierbar festhielt und ihm bis zur letzten Stunde seines Lebens treu geblieben ist. Wie er sich bis zuletzt um alles und jedes aufs lebhafteste interessierte, so entging ihm auch nichts mehr. Wenn Joos Thöny in einer Gesellschaft einem Erzähler widersprach, ob nun von alten oder von jüngsten Vorkommnissen die Rede war, so hatte der letztere die Sache jedenfalls verloren, und wenn er nicht gerne nachgab, war Joos jederzeit im stande, ihm aus andern Daten und Tatsachen unwiderleglichen Gegenbeweis zu leisten. Man möchte fast sagen: es hätten die Zivilstandsregister von Schiers und den Nachbargemeinden können verloren gehen, Joos Thöny hätte sie in der Hauptsache wieder herzustellen vermocht. Eine Uhr besass er nie, und hatte sie auch nicht nötig, denn er wusste stets, bei Tag und Nacht, auch beim dunkelsten Wetter, die Stunde. Wenn er sich am Sonntagmorgen zum Zeichenläuten aufmachte, so brauchte er niemand nach der Zeit zu fragen, er erschien dennoch immer pünktlich, kaum eine Viertelstunde auf oder ab. Für ihn dauerte das goldene Zeitalter immer fort. Wie er selbst andern mit allem, was er hatte oder konnte, stets gerne diente, so galt ihm auch als selbstverständlich, dass andere es ihm tun; und wie er sich ungeniert bei andern zu Tische setzte, so lud er auch in seiner einsamen Behausung – er war immer unverheiratet – allezeit jeden Vorübergehenden ein und nahm es übel, wenn man ablehnte oder nicht tüchtig zugriff, weil diesem oder jenem etwa Bedenken punkto Sauberkeit der Junggesellenwirtschaft aufsteigen mochten. Sein grundehrliches, gerades Wesen war aller Ohrenbläserei und Zwischenträgern abhold. Wie sehr er selber auf Neuigkeiten erpicht war, ausforschen liess er sich nicht gerne, und ein Geheimnis, das er bei sich trug, erfuhren nur die, welche, weil sie ihn kannten, auf seine versteckten Andeutungen hin schwiegen und taten, als interessiere es sie gar nicht. Er redete auch, nach Art vieler einsam lebenden und nachdenksamen Leute, gerne bloss andeutend und gab zu denken und zu erraten. Seine schönste Charaktereigenschaft – oder ich sollte vielleicht eher sagen: die wertvollste Gottesgabe, die ihm zu teil geworden – war seine unzerstörbare Zufriedenheit. Nie hat ihn jemand über seine Lage, sein Befinden, über Wetter, Misswachs, Unfälle am Vieh u. dgl. oder über irgend etwas klagen gehört. Selbst die Erblindung, der er in den letzten Jahren anheimfiel, brachte seinen Gleichmut keinen Augenblick ins Wanken – eine Seelenruhe, womit er viele Hoch- und Fein-gebildete, ja manchen theoretischen Philosophen zu Schanden gemacht hätte. Wenn man ihn bedauerte oder trösten wollte, so war seine gewöhnliche Antwort: „O, ich habe die Welt lange genug gesehen und kann mir sie ganz gut vorstellen.” Und wirklich wusste er auch noch in den letzten Tagen sozusagen jeden Stein in der nähern Umgebung von Schuders.
Ausbruch der Pest in Schuders.
Im 17. Jahrhundert starben im Bergdörflein Schuders fast alle Bewohner an einer pestartigen Krankheit, nachdem ein Hirte dieses Übel von der Alp herab mitgebracht hatte. Dieser Hirte erzählte, er habe auf der Alp im Freien geschlafen. Wie er eines Nachts erwacht sei, habe er einen übelriechenden Nebel vor sich aufsteigen sehen, wovon er dann krank geworden sei und kaum noch Kraft gehabt habe, sich ins Dorf hinunter zu schleppen. Man entdeckte alsobald an ihm die Pestbeulen, und wenige Stunden nachher verschied er. Nun fing die Pest an, im Dörflein ihre vielen Opfer zu fordern, und die Mehrzahl der Einwohner mussten ihr unterliegen.
Kampf mit Wild-Lütli.
Als die Schuderser ihre erste Glocke mit ungeheurer Mühe den steilen Weg von Schiers nach ihrem Bergdörflein hinaufschleppten, kamen ihnen, wie sie eben den Schraubach überschreiten wollten mit ihrer teuren Last, eine Anzahl Wild-Lütli entgegen, die ihnen verwehren wollten, mit der Glocke weiter zu ziehen, denn wie alle Wild-Lütli, hassten auch sie jedes Glocken- oder Schellengeläute und harmonische Getöne. Die Wilden setzten sich ernstlich und entschieden in Widerstand, und es kam zu einer blutigen Schlägerei, in welcher aber die Schuderser Meister gingen (Oberhand behielten), weil ihrer viel mehr waren. Den kürzeren ziehend, kehrten die Wild-Lütli nicht mehr nach Schuders zurück, sondern flüchteten heulend den Bergen zu und schlugen in den bekannten Felshöhlen an der Sulzfluh und im entlegenen St. Antönier-Tale ihre einfachen Behausungen auf.
Der Hexentanz auf Schuders.
In Schuders war einmal ein Knabe, den seine Eltern, geizige Leute, nie zur Gesellschaft junger Leute lassen wollten. Er ging dennoch eines Abends heimlich ins Nachbarhaus, wo es lustig herging. Man sass fröhlich bei einem Glase Wein, tanzte und war guter Dinge. Der Junge hatte seine Freude daran und wünschte, auch tanzen zu können. Er verliess bald die Gesellschaft, denn er musste gehen, um das Vieh zu füttern. Während er so allein war, dachte er immer und immer wieder: „Wenn ich nur auch tanzen könnte.” So sann er hin und her, wie er das erlernen würde, ohne dass es „Spesen” machte, und sann nach, bis es Zeit war, heimzukehren. Eben war er im Begriffe, den Stall zu verlassen, so begegnete ihm unter der Türe ein altes Männlein, das auf die Frage, wo es noch so spät hin wolle, sagte, dass es zu einem Tanze gehe, ob er auch mit wolle? „Das wäre mir schon recht, wenn ich nur dürfte und selber tanzen könnte.” „Komm nur mit, ich will es dich lehren”, erwiderte der Fremde, „du sollst der beste Tänzer und Geiger werden weit und breit.” Der Bube nahm den Vorschlag freudig an, folgte dem Fremden, und bald kamen sie zusammen an ein Dorngebüsch. Der Alte trat in dasselbe, der Junge folgte, und alsbald war kein Dorngebüsch mehr zu sehen, nein, sie befanden sich plötzlich in einem prächtigen, hellerleuchteten Saale. Der Jüngling war sehr erfreut und machte nicht lange Umstände mit den Tänzerinnen, von denen er aber auch nicht eine einzige kannte; auch die Musik kam ihm zwar sehr schön, aber doch „g’spässig” vor. Nach einigen Tänzen kam der Musikant zu ihm her, gab ihm eine Geige und bedeutete ihm, nun solle er spielen. Der Jüngling aber hatte seiner Lebtage nie eine Geige in Händen gehabt und sagte, das verstehe er nicht. „Probier’s”, sagte der Musikant, und richtig, er konnte so schön spielen, dass er selber sich herzlich freute ob seiner so bald und so leicht erlernten Kunst, die er nun daheim im Abendhengert (Abendgesellschaft) so glänzend zeigen wollte. „Aber”, sagte der Musikant, „jedes von unserer Gesellschaft hat sich ins Gesellschaftsbuch einzuschreiben und du wirst es auch tun”, machte auch, ehe der Schuderser sich besinnen konnte, ihm mit einem silbernen Messerlein ein Schnittlein in den Finger, dass er blutete, und tunkte mit einer Feder den Blutstropfen auf. „Da schreib’, ‘s geht wieder an”, und so schrieb der Bursche seinen Namen in das Gesellschaftsbuch ein. Nun blieb er bis nach Mitternacht beim Tanze, ging dann aber, nachdem der Musikant ihm die Geige, mit der er gespielt, zum Geschenk mitgegeben, auch heim. Am Morgen wollte er, schon bei Tagesanbruch, auf der schönen Geige spielen und dieselbe aus seinem Ranzen herausziehen, da zog er statt derselben einen Katzenschwanz hervor.
Das Totenvolk in der Kirche zu Schuders.
Ein Bürger von Schuders musste als vierzehnjähriger Knabe seinem als „Messmer” dienenden Vater eine Zeitlang helfen, den „Tag anleuten”, weil derselbe infolge Verletzung einer Hand nicht allein die Glocke ziehen konnte. Als sie nun in der Christnacht in die Kirche traten, gewahrte der Sohn, nachdem der Vater schon vor der Türe durch eine bedeutungsvolle Gebärde auf etwas Seltsames ihn vorbereitet hatte, eine solche Menge Gestalten, als müssten sie durch dichtes Menschengedränge sich durcharbeiten. Die ganze grosse Versammlung der Gestalten trug schwarze Kommunionstracht. Es folgte nun ein seltsames Gemurmel und dann ein traurig wehmütiger Gesang, dass dem Vater und dem Sohne ganz „wind und weh” wurde. Von der ganzen Gesellschaft vermochte der Sohn nur die damals noch lebende Grossmutter zu erkennen, die aber innert Jahresfrist starb. Als Vater und Sohn vom „Tagläuten” aus dem Turme zurückkehrten, beschien der Mond der Kirche leeren Raum.
Ein Besuch beim Mädchen.
Es ist zehn Uhr. Die Bauern gehen jetzt nach Hause, und wir begeben uns zur Ruhe. Kaum sind wir eingeschlummert, so weckt uns jedoch ein leises, anhaltendes Pochen an der Haustüre. Aha! ein Lediger, der zu seiner „Liebsten” geht! Eine zarte Mädchenstimme fragt nach dem Begehr des späten Wanderers. Dieser antwortet mit verstellter Stimme, doch so leise, dass wir nichts verstehen können. Nach kurzem Gespräch geht die Türe sachte auf, und leise tritt der Jüngling ein. «Ein süsser Kuss, man hört es kaum.» – Bald sitzen die beiden Glücklichen beisammen auf weichem Kanapee, die Hände ineinander gelegt und sich erzählend „von Lenz und Liebe und sel’ger, goldner Zeit”.
Wir schlafen wieder ein, um nach einigen Stunden abermals geweckt zu werden. Um das Haus huschen dunkle Gestalten und pochen an Türe und Fensterladen, zuerst sachte, dann immer energischer, bis endlich von innen aufgemacht wird. Es sind die „Graber”, die ledigen Burschen des Dorfes, die eine Art Sittenpolizei ausüben. Sie werden nun vom Mädchen mit Wein und luftgetrocknetem Bindenfleisch bewirtet und ziehen dann ruhig wieder ab.
Bald steigt der junge Tag von den Bergen hernieder, und auch unser Jüngling denkt: „Es ist bestimmt – – – -.”
Noch einen Blick, einen langen! „Auf Wiedersehn!” Und hinaus tritt der Jüngling in den frischen Sonntagsmorgen.
Dass es aber mit Gefahr verknüpft ist, wenn „Auswärtige” in einem Nachbardorfe „z’Hengert” gehen, ist aus der Schilderung von den Abenteuern zweier Burschen von Schiers zu entnehmen, für welche wir, der Kürze halber, auf Walter Senn: «Prättigau, Natur und Volk im Landquarttale» verweisen und aus welcher wir nur die Schlussmoral hier abdrucken:
„Der Leser, der den Volkscharakter und das ganze Wesen des „Hengerts” nicht genau kennt, wird durch solche Begebenheiten leicht zur Ansicht verleitet, die „Knaben” seien doch rohe Menschen und deren Untaten sollten strenge geahndet werden. Allerdings spricht aus solchen Zügen nicht gerade ein grosses Zartgefühl, aber es steckt doch so ein bisschen Poesie darin, dass die Knabenschaft keine fremden Schmetterlinge an den Rosen ihres eigenen Gartens naschen lassen will und allzu grosse Hitze durch ein Kaltwasserbad so trefflich zu moderieren im stande ist. Sobald indes ein Auswärtiger alles Rechtens mit einem Mädchen ein Liebesverhältnis angeknüpft und vielleicht der Burschenschaft für den Verlust, den sie dadurch erleidet, einen Trunk gegeben hat, so krümmt ihm niemand ein Haar mehr, mag er kommen und gehen, zu welcher Stunde er will.”
Geographisches und Geschichtliches.
Schuders gehört politisch zu Schiers, ist also keine selbständige Gemeinde, hat aber eigene Schule und Kirche und zählt etwas über 100 Einwohner. Diese bilden noch ein einfaches, urwüchsiges Bergvölklein, das sich fast ausschliesslich mit Landwirtschaft und Viehzucht beschäftigt.
Ausser Kirche und Schule besitzt Schuders, wie übrigens alle Fraktionen von Schiers, eine eigene Alp, oder besser gesagt: benutzte seit ältester Zeit eine ihr von der Gemeinde überlassene Alp. Im Laufe der Zeit gelangte es auch zu Kapitalien, gründete einen Armen- und Schulfonds, wählte eine eigene Gemeindebehörde und fühlte sich überhaupt als selbständige Gemeinde. Durch Grossratsbeschluss vom Jahre 1901 jedoch wurde es auf Grund des Gesetzes von 1872 als zu Schiers gehörige Fraktion erklärt.
Die Häuser von Schuders liegen zerstreut, können jedoch in drei Hauptgruppen zusammengefasst werden: 1. Cresta mit Sapra und Galuonia, 2. Valmära mit Cavadura, 3. die Umgebung der Kirche. Zu Schuders gehört ferner der eine Stunde entfernte Weiler Salfsch. Hier ist es im Sommer recht einsam, dagegen herrscht im Winter meist reges Leben, da in den nahe gelegenen Waldungen (Sonniwald und Liziwald) fast alljährlich grosse Partien Holz geschlagen werden. Über Salfsch gelangt man in drei Stunden nach St. Antönien.
Schuders gegenüber, durch ein tiefes Tobel getrennt, liegen die „Waschkräuter”, Schierser Maiensässe. Über denselben erhebt sich das rühmlichst bekannte Kreuz, ein aussichtsreicher Rasenberg von 2200 m. Höhe. Den Rücken deckt uns die 2400 m hohe Girenspitze, ein Vorposten der Rhätikonkette. Gegen Osten ragen, wie mit Rasiermessern geschnitten, die schroffen Kalkwände der Sulzfluh und Drusenfluh bis zu einer Höhe von 2829 m, in den blauen Äther empor. Die Vorberge Hurscher, Schafberg und Kühnihorn werden überragt von den Granden der Rätschenfluh und der Madrisa. So liegt Schuders idyllisch an sonnigem Bergeshang, inmitten sattgrüner Wiesen und harzigduftender Wälder, umgeben von einem grossartigen Gebirgspanorama. Eine herrliche Gegend für Sommerfrischler: gesunde, ozonreiche, staubfreie Luft, Ruhe und stille Einsamkeit, herrliche Spaziergänge in Wiese und Wald und Alpen, Gelegenheit zu grossen und kleinen Bergtouren.
Jede Familie hat ihre besonderen Zeichen: Hauszeichen, Holzzeichen und Viehzeichen. Mit dem Holzzeichen wird im Walde geschlagenes Holz gezeichnet. Das Hauszeichen wird auf Gerätschaften und Holzgefässen angebracht, sowie in der Stube über der Türe; es ist gleichsam das Familienwappen. Dem Schmalvieh (Schafen und Ziegen), hie und da auch dem Grossvieh wird ein Zeichen in die Ohren geschnitten. Seitdem die Gemeinatzung (allgemeiner Weidgang im Frühling und Herbst) abgeschafft worden, ist der Kleinviehstand enorm zurückgegangen, während früher sozusagen jede Familie bis zwanzig und mehr Stück hielt. …
Spaziergänge und Touren.
(Ein Weg)
Schuders—Maiensässe 1 Stunde
Schuders—Girenspitze (2400 m) 3 ½ Stunden
Schuders—Steinhüttli—Colrosa 3 Stunden
Schuders—Colrosa—Scesaplana (2969 m) 6 Stunden
Schuders—Colrosa—Lünersee 4 ½ Stunden
Schuders—Lünersee—Scesaplana 7 ½ Stunden
Schuders—Lünersee—Brand 6 Stunden
Schuders—Colrosa—Scesaplanahütte 4 ½ Stunden
Schuders—Scesaplanahütte—Scesaplana7 ½ Stunden
Schuders—Scesaplanahütte—Kleine Furka 6 Stunden
Schuders—Kleine Furka—St. Rochus—Nenzing 10 Stunden
Schuders—Vorderälpli 1 ½ Stunde
Schuders—Vorderälpli—Schweizertor 3 ½ Stunden
Schuders—Schweizertor—Rellstal—Montafun 9 Stunden
Schuders—Schweizertor—Ofenpass—Gauertal—Schruns 9 Stunden
Schuders—Schweizertor—Lünersee 5 Stunden
Schuders—Salfsch 1 Stunde
Schuders—Salfsch—Hurscher (2007 m) 3 Stunden
Schuders—Salfsch—Kühnihorn (2416 m) 4 Stunden
Schuders—Salfsch—Schafberg (2463 m) 4 Stunden
Schuders—St. Antönien über Salfsch 3 ½ Stunden
Schuders—Salfsch—Kreuz (2200 m) 5 Stunden
Schuders—Salfsch—St. Antönien—Sulzfluh (2820 m) 8 ½ Stunden
Schuders—Drusenalp—Sporrafurka 5 Stunden
Schuders—Drusenalp—Sporrafurka—Drusenfluh (2829 m) 9 Stunden
Landwirtschaftliche Arbeiten.
Ackerbau wird auf Schuders sozusagen nicht getrieben. Kartoffeln und etwas Gemüse, wie Kohl und Rüben, sind das einzige, das noch angepflanzt wird. In Valmära stehen noch einige Obstbäume, doch ist der Ertrag gering; dagegen wächst ein vorzügliches Heu.
Im Frühling müssen die Wiesen von Holz und Steinen etc. gereinigt und gedüngt werden, welch letzteres besonders an steilen Halden eine recht mühsame Arbeit ist. Zwei Ochsen werden ins Joch gebunden und an einen zweirädrigen, breiten, aber niedern Wagen gespannt. Auf diesen sogenannten „Redig” wird die Mistlade gebunden und darin der Dünger auf die Wiesen geführt. Ein solches Zweigespann nennt man „Brilmeni”. An ganz steile Halden, wo man auch mit diesem Vehikel nicht hinfahren kann, muss der Dünger in einer „Kräze” hingetragen werden.
Besonders anstrengende Arbeit haben die Bauern zur Zeit der Heuernte. „Frühmorgens, wenn die Hähne kräh’n”, stehen die Erwachsenen auf, nehmen einen Imbiss, „ds’ Entnüechtera” genannt, und begeben sich dann an die Arbeit. Jedes nimmt im Stallhof seine Sense vom Nagel, bindet das Steinfass um und geht hinaus auf die Wiese. Rauschend fährt die scharfe Sense durch das taufrische Gras und mäht es zu Schwaden. Maschinen kennt man hier nicht, könnten auch kaum verwendet werden.
Der Ätti mäht voran, Söhne und Töchter folgen ihm. Die Mutter bereitet unterdessen das Frühstück und bringt es dann ins Heu. Es besteht aus Kaffee mit Erdäpfelrösti oder Ribel. Nach dem Essen wird weiter gemäht; Kinder und Frauen breiten das abgeschnittene Gras zum Dörren aus. Ein Bauer, der eben vorbeigeht, ruft: „Haut’s-es?” und der Angeredete erwidert: „Ä Bitz.” – „Jetz ist rächt Heuwätter, ma hed aber au z’tua, gwüss erger as d’Müsch in dr Chimbetta.” – „Ja mer wen-nisch gära lida.” – „Sälb scho. Len-ni ä Bitz derwil. Bhüeti Gott.” „Es gschied scho. Bhüeti Gott Christa.”
Sobald das am Vortag geschnittene Heu vom Tau trocken und oben dürr ist, wird es mit dem Rechen gewendet. Heiss brennt die Sonne über die Mittagszeit. Die Bauern, die sich begegnen, haben jetzt nicht Zeit zu langen Gesprächen. „Hüt git’s dürrs”, sagt der eine; „Ja, hüt git’s guot’s”, erwidert der andere. Nach dem Mittagessen wird nicht lange Siesta gehalten. Das dürre Heu wird jetzt in Stricken gebunden und auf dem Rücken zum Stalle getragen.
Ist das Wetter beständig, so wird am Abend noch ein Stück gemäht, andernfalls muss man das am Vormittag geschnittene Heu zu Schwaden zusammenrechen oder auf „Heinzen” legen. Heinzen nennt man zirka 1 ½ Meter hohe Pfähle, die in den Boden eingetrieben werden, und die mit drei kreuzweise übereinander eingebohrten „Sprossen” versehen sind, auf welche die Heubüschel zu liegen kommen. Das Heu leidet so auch bei mehrere Tage andauerndem Regen nicht. Am ersten schönen Tage wird es dann zum Dörren ausgebreitet und eingeheimst.
Die Arbeiten, die im Winter zu verrichten sind, erstrecken sich meistens auf Haus und Wald. Bald muss der Bauer an einer jähen Felsenwand Holz fällen, bald holt er aus einem höher gelegenen Heugaden eine Ladung Futter für sein Vieh. Siehst du ihn auf seinem grossen Schlitten in kühnen Sätzen eine Schneehalde herunterfahren, so möchtest du für sein Leben besorgt sein! Er selber ist das nicht. Derartige Fahrten sind ihm zur Gewohnheit geworden; er vertraut auf seine Kraft und das gute Geschick. „In Gotts Nama” beginnt er alle seine Unternehmungen.
Am Morgen und am Abend muss das Vieh gefüttert werden. Ist dies geschehen, sind all die Geschäfte in Stall und Scheune besorgt, „der reine Schaum der Euter ausgedrückt”, wie Haller sagt, so lenkt der Vater seine Schritte wieder der häuslichen Wohnstätte zu. Frohsinn und Heiterkeit empfangen ihn dort. In mächtiger, irdener Schüssel trägt die Mutter die Mahlzeit herbei, und die Hausgenossen sammeln sich um den grossen Tisch. Teller gibt es keine, alles taucht in das gemeinschaftliche Gefäss, und sollte es einmal zu einem Löffelgefechte kommen, wie weiland zwischen den feindlichen Eidgenossen bei Kappel, so sorgt der Vater mit wohlgezieltem Schlage für baldige Eintracht.
Hirsche in Schuders.
Bedeutenden Schaden richtet in den Wiesen nicht selten das zahlreiche Hirschwild an, besonders an stillen, abgelegenen Orten. Im Winter kann man von Salfsch aus in den schneefreien Lawinenstrichen hinter Schuders zuweilen bis dreissig Stück beisammen sehen; in mondhellen Nächten kommen sie sogar bis zu den Häusern bei der Kirche. Um Hundegebell, Pfeifen etc. kümmern sie sich um diese Jahreszeit meistens herzlich wenig. Im Frühling weiden sie dann die Bergwiesen ab und lagern ungeniert im schönsten Gras. In einer Wiese hinter dem Dorfe hatte ein Bauer, um die Tiere fernzuhalten, eine Scheuche aufgestellt, indem er einen Heinzen in den Boden trieb und mit alten Kleidungsstücken behängte. Als er aber nach einigen Tagen wieder hinkam, lag die Scheuche am Boden und ringsherum fanden sich frische Hirschspuren.
Schwer litten diese Tiere im Winter 1906/1907. Es waren eben ganz ausserordentliche Verhältnisse, indem ungewöhnlich viel Schnee fiel und nirgends Schneerutsche entstanden, so dass die armen Tiere keinen apern Boden fanden. Eines Tages begaben sich die Wildhüter mit Heu ins Salginertobel. Bald entdeckten sie eine frische Hirschspur hinunter gegen den Bach, fanden daselbst aber nichts, auch keine Spur vom Bache weg. Nun wurde der Flusslauf bergwärts verfolgt, und richtig, mitten im Wasser lag ein Spiesser, der zwar noch lebte, aber nicht mehr die Kraft besass, das Ufer zu erklimmen. Das arme Tier wurde nun aus seiner misslichen Lage befreit, nach Busserein gebracht und dort einem Bauer in Verpflegung gegeben, wo es die gereichte Nahrung gerne annahm und sich bald erholte.
Am gleichen Abend brachte ein Holzfuhrmann die Nachricht, im Salginertobel habe er einen halbverhungerten Elfender gesehen und ihm vorläufig den Inhalt seines Heusackes serviert. Am folgenden Tage begab sich Wildhüter Davatz abermals in diese Gegend und entdeckte das Tier oberhalb des Weges auf einem kleinen Vorsprung. Mit Mühe erreichte er die Stelle; das ermüdete Wild machte keine Miene, sich zu entfernen. Erst als D. es bei den Hörnern nehmen wollte, setzte es sich mit Aufbietung seiner letzten Kräfte zur Wehr. Nun wurde es mit einer in einem nahen Gebüsch geschnittenen Gabel über den Vorsprung hinuntergestossen, von wo es durch die eben getretene Spur des Wildhüters in den Weg gelangte und dann demselben folgend sich talwärts wandte. Beim sogenannten Crestabrückli wurde das abgemattete Tier eingefangen, an einen Strick gebunden und wie ein Haustier weiter transportiert, als ginge es auf den Markt. Schliesslich versagten aber seine Kräfte, und es musste auf einen Schlitten geladen werden. So hielt der arme „Hürni” abends 5 Uhr seinen Einzug in Schiers.
Hinter diesem Schlitten folgte gleich ein zweiter, beladen mit einer erschöpften Hirschkuh. Ein Holzer war in Fadiel unterhalb Schuders auf dem Wege an seine Arbeit auf einen toten Hirsch gestossen, der rücklings in ein Gebüsch eingeklemmt dalag. Bald darauf bemerkte er in der Nähe drei weitere noch lebende Tiere, von denen sich zwei entfernten, das dritte jedoch liegen blieb. Er schaffte nun dieses halbtote Tier, einen Spiesser, an den Weg hinunter und wollte weiter draussen einen Schlitten holen, um es aufzuladen. Auf dem Wege dahin bemerkte er jedoch im Bache eine junge, ebenfalls noch lebende Hirschkuh, die aber nicht mehr weiter konnte. Schnell wurde ein in der Nähe befindlicher Schlitten requiriert, das arme Tier aufgeladen und ins Dorf geschafft, während der zuerst aufgefundene Spiesser vorläufig seinem Schicksal überlassen wurde. Sobald jedoch der Salginerhürni und die unter Fadiel gefundene Hindin in Gewahrsam gebracht waren, wurde auch der arme Spiesser per Extrapost abgeholt. Abends 9 Uhr traf die letzte Expedition unter Leitung von Wildhüter Davatz mit grossem Gefolge in Schiers ein. Die drei Tiere wurden von Landjäger Hartmann in Pension genommen. Zuerst wurde ihnen ein Trunk frische Milch verabfolgt und dann Heu vorgelegt. In der ersten Zeit erholten sie sich scheinbar ordentlich, bald jedoch standen die zwei kleinern Tiere um, während der Elfender im Frühling mit dem auf Busserein in Verpflegung gestandenen Spiesser in den Wildpark von St. Moritz i. E. verbracht wurde.
Der Holzer Disch, welcher die Tiere in Fadiel gefunden hat, sagte, dass er an jenem Tage im Schraubachgebiet nicht weniger als 33 Stück gesehen habe. Ausserdem hielt sich eine Anzahl in Salgina und 15 bis 20 Stück oberhalb Busserein auf. Am besten erging es der Kolonie in den Kirchenstauden bei Schuders, welcher etwa zwei Dutzend angehörten. Auf einem ganz nebenausliegenden Heuschober fanden sie zirka ein Fuder Heu, das sie „rübis und stübis” verzehrten. Am hellen Tage sah man elf Stück in Reih’ und Glied den Stall verlassen.
Von verschiedenen Seiten wurden Beiträge eingesandt zum Ankauf von Nahrung für die notleidenden Tiere. Der Landwirteverein Turbental sandte gratis sechs Ballen Emd, und die Rhätische Bahn sagte hierfür ohne weiteres taxfreien Transport Landquart-Schiers zu.
Bis im Frühling fand man gegen dreissig tote Tiere, einzelne wurden durch die Schneewasser des Schraubaches zu Tal geschwemmt. Eine auf Schuders gefundene tote Hirschkuh war in beiden Ohren gezeichnet, woraus mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass das Tier früher einmal in Gefangenschaft lebte.
Trotz des grossen Abganges im Winter 1906/1907 ist ein Aussterben des Hirschwildes nicht zu befürchten. Im Frühling wurden bei den Maiensässen oberhalb Schuders wieder mehrmals über zwanzig Stück beobachtet; auch gibt es aus dem benachbarten Montafun immer wieder Zuzug. Sodann dürfen nur ältere männliche Tiere geschossen werden: ein Abschiessen dieser Tiere aber ist für den Fortbestand der Hirsche im Rhätikongebiet nur von Vorteil. Übrigens ist der Hirsch schwer zu jagen: denn während des Tages hält er sich im dichtesten Gebüsch versteckt und kommt nicht hervor, auch nicht, wenn Menschen ganz in seine Nähe kommen.
Gebäulichkeiten.
Haus und Stall sind einfache Holzbauten. Das Haus steht gewöhnlich links, also gegen Osten, der Stall rechts, etwas zurücktretend und vom Haus durch einen kleinen Zwischenraum getrennt. Das gewöhnliche Haus ist das gestrickte Anderthalbhaus; seltener sind das einfache und das doppelte Haus. Der Eingang ist bald von Osten, bald von Westen, meistens jedoch von Osten, während die Hausfront nach bilden steht. Einen durch einige Tritte erhöhten Eingang nennt man „Schorli” oder „Läubli”.
Der erste Raum, in welchen man eintritt, heisst Vorhaus (Treppenhaus). Aus demselben gelangt man nach unten über eine Treppe in die Kemmete und in den Keller, nach oben auf die innere Laube. Der Haustüre direkt gegenüber findet sich die Küche, und rechtwinklig zu dieser gelangt man in die Stube. Aus der Stube führt eine Türe in die Nebenstube oder Nebenkammer.
Neben der Stubentüre, auf der Seite gegen die Nebenstube, steht der mächtige Steinofen mit hoher Gupfe, hinter welchem eine kleine Treppe hinaufführt auf die obere Kammer. Auf der einen Seite des Ofens ist das Gutschi, auf der andern Seite die Ofenbank, unter welcher früher meistens die „Hennachebia” angebracht war. Jetzt hat das gackernde Hühnervieh auch hier aus der Stube verschwinden müssen. Auf der andern Seite der Stubentüre steht das Buffet, bestehend aus zwei „Schgäffli” unten und einem Gestell für Tassen und Teller oben. Früher stand daneben meistens noch ein kleines, hohes Buffet mit je einem „Schgäffli” unten und oben und einer Platte mit Waschbecken und darüberhängender Giesskanne in der Mitte.
Zwei kleine Doppelfenster gegen Süden und ein solches gegen Osten, resp. Westen, spenden das nötige Licht. In der Ecke zwischen den Fenstern steht der grosse Esstisch, und an den Wänden herum befinden sich solide Bänke. Wände und Decke sind getäfelt. Über der Türe werden in der Regel Name und Hauszeichen des Besitzers, sowie die Jahreszahl eingeschnitten und über den Fenstern steht nicht selten ein frommer Spruch. Auf einem kleinen Gestell in der Ecke über dem Tisch liegen einige dickleibige, in Schweinsleder gebundene Andachtsbücher; daneben befindet sich der Kalenderhalter mit der „Brattig”. Auch die alte Schwarzwälderuhr fehlt in keiner Stube.
Die Nebenstube dient meistens als Schlafzimmer, ebenso die über Stube und Nebenstube gelegenen zwei Kammern. Dieselben haben in der Regel nur kleine und wenige Fenster. Über der Küche und dem Vorhaus liegen das Fleischgemach und die innere Laube. Einen grossen Teil dieser Laube nimmt der mächtige Kaminschoss weg. Häufig finden wir hier auch die Brothange. Von der inneren Laube gelangt man auf die äussere Laube, die meistens mit Rosmarin- und Nelkenstöcken geziert ist. Der Raum unter dem mit Steinen beschwerten Schindeldach wird „Dilli” genannt. Aussen an der Giebelseite des Hauses finden sich oft mehr oder weniger sinnreiche Sprüche. Z. B:
„Gott bewahre dieses Haus Und die da gehen ein und aus.”
„Lass’ Neider neiden und Hasser hassen; Gott kannst du alles überlassen!”
„Veracht’ nicht mich und die Meinen, Betracht’ erst dich und die Deinen! Findst du dann ohne Mängel dich, Alsdann komm’ und verachte mich!”
„Dies Haus ist mein und doch nicht mein, Und meinem Sohn kann’s auch nicht sein. Und wird’s dem Dritten übergeben, So wird’s dem ebenso ergehen. Den Vierten trägt man auch hinaus; Nun! sagt mir doch, wess’ ist dies Haus.”
„Ich hab’ gebaut nach meinem Sinn; Drum, Neider, geh’ nur immer hin; Und wem die Bauart nicht gefällt, Der mach’ es besser für sein Geld.”
„Was stehst du da und tust mich schelten? Geh’ weiter, Narr! Und lass’ mich gelten.”
„Was ich in Sorg’ und Müh’ gebaut, Kann ich nicht lang’ besitzen. Das Haus, das Gott mir anvertraut, Wird einst ein And’rer nützen. Ein Dritter kommt und nimmt es ein; Und dann werd’ ich vergessen sein.”
Der Stall ist meistens auch ein Anderthalbstall, bestehend aus Kuh- und Zustall. Mitten durch den Kuh- oder Hauptstall läuft ein Gang. Auf der einen Seite desselben sind drei Abteilungen für je zwei Kühe und auf der andern Seite findet sich der Raum für Jungvieh, besonders für Kälber. Zu hinterst im Gang steht die „Rüschla”, in welche vom Heuboden das Heu heruntergeworfen wird. Vorn im Stall neben der Türe befindet sich das Borbett. Der Zustall ist nur einseitig und dient zur Unterbringung von Jung- und Kleinvieh. Vor dem Stall ist der Stallhof, auch Brugg genannt. Über dem Hauptstall liegt der Heuboden, über dem Zustall das Tenn und das Montaschiel und über dem Stallhof die Talina.
An Haus und Stall angebaut, finden sich noch allerlei Nebengebäude, wie Holzhaus, Schweinestall, Streuefanilla, Wasserhütte etc.
Aufrüsten und Transport des Holzes.
In den ausgedehnten umliegenden Waldungen werden fast jedes Jahr grössere Partien Holz geschlagen und durch das tiefe, im Sommer unpassierbare Tobel nach Schiers geführt. Im Herbst wird von einheimischen Arbeitern und Italienern aus dem obern Veltlin mit dem Aufrüsten des Holzes begonnen. Diese Waldarbeiter bleiben die ganze Woche im Walde. Da bauen sie sich aus rohen Holzstämmen eine sogenannte Schröterhütte, die als Küche und Schlafstätte dient. Der Eingang ist meistens so niedrig, dass man nur in gebückter Stellung ein- und ausgehen kann; Fenster und Kamin fehlen. Im Innern finden sich der mächtige Feuerwagen und die mit Reisig, Moos oder Rietgras belegte, recht harte Schlafstelle. Da bereiten sich die Holzer ihre nicht gerade lukullischen Gerichte Tatsch und Polenta und legen abends ihren müden Leib zur Ruhe. Um sich gegen grosse Kälte zu schützen, schlüpfen sie in einen Sack oder unter eine Decke und unterhalten auch etwa die ganze Nacht das Herdfeuer.
Das Aufrüsten des Holzes ist eine schwere Arbeit, die Vorsicht und Geschick erfordert. Als Werkzeuge dienen Waldsäge, Axt und Zapin. Die Holzer müssen es verstehen, eine Tanne so anzuschneiden, dass sie dahin fällt, wo man sie eben haben will. Um dies zu erreichen, muss sie manchmal vor dem Fällen entastet und angebunden werden. Der gefällte Baum wird in etwa 5 ½ Meter lange „Tütschi” verschnitten.
Um das geschlagene Holz ins Tal zu befördern, müssen oft kostspielige Wege angelegt werden. Dieselben werden eingegraben oder auch aus Gipfelholz und Ästen hergestellt und aussen mit „Verleggenen” versehen. Dieses Vorlegen kleiner Blöcker, die durch fest eingetriebene Pfähle gehalten werden, gibt dem Weg eine Art Randmauer, sowie eine hohle Form, wodurch das Ausgleiten der Schlitten verhindert wird. Tiefe Abgründe und gähnende Schluchten müssen oft in kühnen Bogen übersetzt werden. Solche Brücken erreichen bisweilen eine Länge von 400 bis 500 Metern. Mit dem Transport des Holzes kann erst begonnen werden, wenn Schnee und Kälte eintreten und der Weg dadurch die nötige Festigkeit erhält. Zur Unterhaltung des Weges sind besondere Weger da.
Das Führen des Holzes ist eine anstrengende und gefährliche Arbeit. Mann und Ross müssen sich auskennen, sonst geht es schlimm. Etwa um 4 Uhr morgens wird eingespannt, und dann geht’s in langem Zuge nach den 4 bis 5 Stunden entfernten Holzladeplätzen. Schellengeklingel und fröhliche Jauchzer ertönen aus tiefer Schlucht herauf. In der Alp werden die mit einem „Paluog” (Einschnitt) versehenen Blöcker schnell auf die eigens konstruierten Bockschlitten geladen, ein bis drei Stück auf das Pferd, je nach der Grösse der Hölzer und der Beschaffenheit des Weges; dann geht es auf schwindligen Pfaden hinaus ins Tal. Wo der Weg starkes Gefälle aufweist, wird eine Kette um den einen Lauf des Schlittens gelegt und so eine Art Bremsvorrichtung geschaffen. Hie und da kommt es vor, dass ein Schlitten umwirft und auch das Pferd zu Falle kommt. Doch eilt man sich gegenseitig zu Hülfe, und bald ist wieder alles im Gang. Unglücksfälle sind wider Erwarten recht selten. Ausnahmsweise wird an steilen Orten das Holz auch gerieset. Doch leidet es nicht selten bedeutenden Schaden, besonders wenn ihm durch ein „Pardell“ plötzlich eine andere Richtung gewiesen werden muss. Das Brennholz wird meistens geflösst, welche Arbeit aber weder angenehm noch der Gesundheit zuträglich ist.
Lawinen.
Eine grosse Gefahr für Waldarbeiter und Holzfuhrleute bilden oft die zu Tale fahrenden Lawinen. Besonders der Winter von 1893 forderte seine Opfer, indem in der zweiten Hälfte des Monats Januar mächtiger Schneefall eintrat. Wie Glaskörner war der Schnee, hart und spröde; rauschend fiel er nieder und fand nirgends Halt. Überall entstanden Schneerutsche und Lawinen, sogar mitten im Wald. Trotzdem gingen die Waldmänner, wetterharte Kraftgestalten, an ihre gewohnte Arbeit.
Aber schon auf dem Marsche fanden sie den Weg nicht selten durch mächtige Schneemassen verschüttet und hatten Mühe, sich durchzuarbeiten. Hie und da stürzte auch plötzlich eine Lawine nieder und riss Mann und Ross in die Tiefe, und zwar an Stellen, die für durchaus gefahrlos galten. Allemal gelang es jedoch, die Verschütteten herauszuschaufeln und so Dutzende dem drohenden Tode zu entreissen. Am 25. Januar aber fiel ihm doch einer zum Opfer. Es war ein gewisser Hans Jecklin von Busserein. Gegen Abend verschüttete eine Lawine in der sogenannten Hell beim Salfscherbrückli unterhalb Schuders sein Zugtier, einen wertvollen, vierjährigen Ochsen. Mit Gewalt mussten die Begleiter, die neue Gefahr ahnten, den Jecklin fortschleppen. Doch diesen reute das schöne Tier; unbemerkt kehrte er wieder um und fand an der nämlichen Stelle seinen Tod. Von der Lawine gegen einen Felsen gedrückt, die Arme wie nach Luft ringend über das Gesicht erhoben, wurde er aufgefunden.
Der nämliche Tag wurde auch noch andern verhängnisvoll. Ein ausserordentlich kräftiger Mann, der im Schraubachgebiet mit Aufladen von Holz beschäftigt war, wurde mitten im Walde plötzlich von einer Lawine in die Tiefe gerissen. Als die Schneemasse zum Stehen kam, lag der Mann auf seinem Gesichte. Doch hatte er die Geistesgegenwart nicht verloren, und da er merkte, dass der über ihm lastende Schnee nicht gar zu tief sein konnte, versuchte er, die Schneedecke zu durchbrechen, indem er mit dem Rücken nach oben stemmte. Der Versuch gelang. Nun bemerkte er erst, dass er einen Beinbruch erlitten hatte und ein Weiterkommen unmöglich war. Auf seine Hülferufe kamen bald andere, in der Nähe beschäftige Holzarbeiter herbei. Sorgfältig und unter unsäglichen Mühen trugen sie den Verunglückten auf einer aus Tannästen hergestellten Tragbahre den steilen Hang hinauf. Der Schnee lag so tief, dass der grösste Schuderser, der wohl über sechs Fuss misst, oft bis an den Kopf eingesunken sei. So waren die Kräfte unter der schweren Last bald erschöpft, und man beschloss, von Schuders Hülfe zu holen. Nur langsam und mit grösster Anstrengung gelang es dem Boten, sich durchzuarbeiten.
Während die Kolonne langsam dem Bergdörfchen zustrebte, ertönten plötzlich von Salfsch her Hülferufe. Dort waren vier Brüder an ihrer Arbeit gewesen, als unvermutet eine Lawine einen derselben zudeckte. Doch gelang es den Dreien bald, ihren Bruder zu retten.
Das Schrecklichste aber sollte erst noch kommen. Von neuem setzte kräftiger Schneefall ein. Am Sonntag nach diesen Vorfällen hatten die Schuderser eine Abstimmung, ob man von den Maiensässen weg einen Holzweg ins Salginertobel ausschaufeln wolle. Alte, erfahrene Männer warnten eindringlich vor dem Vorhaben, da die Lawinengefahr noch zu gross sei. Die Jungen jedoch, welche die Mehrzahl bildeten, waren für den Plan und freuten sich ihres Sieges. Am Montag den 31. Januar wurde mit dem Pfaden begonnen. Nur ungern taten die Alten mit, und bald zeigte es sich auch, dass das Unternehmen zu gefährlich war. Man beschloss also, die Arbeit zu verschieben; noch wollten drei junge Männer nachsehen, ob die grosse Lawine hinter Sapra schon niedergegangen sei. Dabei brach einer so tief in den Schnee ein, dass er längere Zeit brauchte, sich herauszuarbeiten. Diese Verzögerung rettete ihm das Leben, denn plötzlich hörte er ein Geräusch und sah direkt vor sich die Lawine niederfahren. Er musste zusehen, wie seine Gefährten Hartmann Bärtsch und Simeon Tarnutzer, stehend, die Schaufel in der Hand, über den Schneemassen dem schauerlichen Abgrunde zuschwammen. Als die beiden bereits in gähnender Tiefe verschwunden waren, hob der Wirbelsturm noch einmal höhnend die Hüte der Verunglückten über den Abgrund.
Von Schrecken förmlich gelähmt, erreichte der Überlebende kriechend die Maiensässe, wohin die übrigen Weger sich schon zurückgezogen hatten. Sofort stiegen sie ins Tobel hinunter, die Verschütteten auszugraben. Der Leiter der Expedition war Vater des einen und Schwiegervater des andern Verunglückten! Unter grösster Gefahr wurden die Bergungsarbeiten vorgenommen. Während die einen als Lawinenwächter auf Posten standen, schaufelten die andern den Schnee weg. Nach mehrstündigem, anstrengendem Suchen wurde der eine von seinem eigenen Vater als formlose Masse gefunden. Im Mondschein kehrte der traurige Zug nach Schuders zurück; der Leichnam des Ältern konnte erst am folgenden Tage geborgen werden.
Die Beerdigung der beiden fand am Donnerstag statt, wobei sich zwei Zufälle ereigneten, die unter der Bevölkerung grösstes Aufsehen erregten. Zuerst wurde der Leichnam des Ältern aus dem Trauerhause geholt. Als aber der Sarg niedergestellt wurde, brach die Bahre entzwei. Das Merkwürdige war, dass der Tote, der Kirchenvorsteher war, kurz vorher eine neue Bahre hatte anschaffen lassen, da die alte morsch sei. So wollte es der Zufall, dass noch sein Leichnam gegen die alte Bahre Protest einlegte.
Und nun sollte ein Ereignis eintreten, das noch grössere Erregung hervorrief. Die beiden Verunglückten wurden in ein und dasselbe Grab gelegt, und eben schickte ein kleiner Chor sich an, einen Trauergesang anzustimmen, als vom Dach des Kirchleins ein Schneerutsch niederging, direkt in die offene Gruft. Tief ergriffen rief einer der Anwesenden aus: „Die müssen einfach im Schnee sein.” Wohl noch nie hatte eine Beerdigung die Gemüter so erregt wie diesmal. An der Unglücksstätte am Maiensäss hat man den Verunglückten ein einfaches Denkmal gesetzt.
Über einen Lawinensturz aus früherer Zeit findet sich in einem alten Schuderser Kirchenbuch folgende Aufzeichnung: „Anno 1811, den 3./4. Februar a. St., fällte es in den Berggegenden, während es im Land meistenteils regnete, in kurzer Zeit einen so grossen Schnee, dass wenigstens hier auf Schuders derselbe 6 bis 7 Schuh hoch lag. Am 4. dies, morgens, war der Schnee so locker und leicht, dass er an allen Hügeln losbrach und furchtbar herabfuhr. Ungefähr morgens um 8 Uhr kam ein Stoss Schnee vom Plaswald herunter und setzte den obern Teil des sogenannten Stöcklihauses über die Hälfte ein. Obschon die Beschaffenheit des Schnees an diesem Morgen keine grosse Gefahr befürchten liess, so stiess er dennoch auf beiden Seiten des Hauses liegende Bretter und Holztrümmer einige Schritte weit herunter. Im übrigen verursachte er am Haus keinen Schaden. Das unaufhörliche Schneien und ein am Abend ungefähr um 6 Uhr eintretender Sturmwind riss den Schnee los, ob er schon am Nachmittag tauiger geworden. Unmittelbar um Bruchrain brach er los und stiess mit solcher Gewalt herunter, dass die Schneelawine im Vorbeistreichen schon den Ägertengaden zertrümmerte und dann auf das über 100 Jahre ihr im Mittelpunkte stehende doppelte Stöcklihaus kam, dass sie die ersten zwei Wände der Fleischkammer ganz zerscheiterte und sechs der dicksten Firsten zerbrach. Die obere Mauer litt durch diesen heftigen Stoss sehr stark, besonders das Kamin, welches zuerst einstürzte, dem dann die hintere Mauer folgte. Die zwei Stuben, von welchen die äussere seit 80 Jahren die Pfrundstube war, und die zwei Oberkammern blieben zwar aufrecht; dennoch hatte es die Täfel verzogen und die Öfen verspalten.
In der andern arg beschädigten Hälfte des Hauses befanden sich zur Zeit des Unglückes nur einige Kinder. Doch blieben sie alle unversehrt und wurden vom Pfarrer, der zwischen den zerbrochenen Firsten in den andern Teil des Hauses sich hindurcharbeitete, aus ihrer peinlichen Lage befreit. Die Lawine stürzte, ohne jedoch weiterhin nennenswerten Schaden zu verursachen, hinunter gegen Valmära und bis ins Tobel. Das arg beschädigte Haus wurde abgebrochen und andernorts aufgebaut.”
Sitten und Gebräuche.
Eine Hochzeit in Schuders ist eine Seltenheit und wird von der ganzen Gemeinde oder doch von der gesamten ledigen Gesellschaft mitgefeiert. Am Morgen versammelt man sich im Hause der Brautleute bei Glühwein und Backwerk. Bist du noch unverheiratet, so wird dein Hut von irgend einer Schönen mit einem Rosmarinzweig geschmückt. Hierauf begleitet man das Brautpaar zur Einsegnung in das Kirchlein.
Das Festessen findet im Hause des einen der Ehegatten statt und weist seit Grossvaters Zeiten dasselbe bewährte Menu auf. Zuerst erscheint eine kräftige Gerstensuppe; dann folgen geräucherter Schinken mit Reis und Kastanien und als zweiter Gang Schafragout mit Äpfelschnitzen. Als Nachtisch gibt es Küechli und „goldene Bohnen”. Letztere werden aus Mehlteig hergestellt, in süsser Butter gebacken, mit Bienenhonig getränkt und munden vorzüglich. Nach dem Essen wird ein gemütlicher Tanz veranstaltet, wobei die Burschen den Rock ausziehen, ihre Brissago rauchen und kräftig den Takt stampfen.
Ein ähnliches Festessen, „Gsächeti” genannt, findet statt, wenn ein junger Erdenbürger aus der Taufe gehoben wird. Gsächeti heisst es wahrscheinlich deshalb, weil die Wöchnerin zum erstenmal wieder öffentlich gesehen wird. Als Taufpaten werden nächste Anverwandte oder Befreundete gewählt, mit Vorliebe solche, die sich gegenseitig „wohl leiden mögen”, oder solche, die man „zusammenbringen” möchte.
Trauer für die ganze Gemeinde bedeutet ein Todesfall in Schuders. Doch sind dieselben so selten, dass der Pfarrer mit jenem andern sagen könnte: In meiner Gemeinde stirbt jährlich durchschnittlich niemand. Ist eine Person gestorben, so wird bei der Leiche Wache gehalten bis zur Beerdigung, auch während der Nacht. Aus jedem Haus findet sich an einem oder dem andern Abend mindestens ein Glied als „Wacher” ein. Mit dem Gruss: „Ist N. im Herrn entschlafa, so gäb ihm der lieb Gott a fröhlechi Uferstehig und ünsch alla äs gnedigs End”, tritt man ins Trauerhaus. Und mit den Worten: „Das tüe Gott”, wird der Gruss erwidert.
War die Verstorbene eine unverheiratete Person, so flechten die Mädchen des Dorfes einen Kranz auf den Sarg, und die Leichenträger, aus der Schar der ledigen Burschen gewählt, werden mit einem Rosmarinzweig geschmückt. Ist die Verewigte eine ältere, verheiratete Person, so werden als Leichenträger in erster Linie diejenigen Männer gewählt, die seinerzeit von ihr aus der Taufe gehoben wurden.
Früher wurde der Jahreswechsel von den Schulknaben in der Weise gefeiert, dass sie am Altjahrabend von Haus zu Haus zogen und aus dem Bachofen oder dem Psalmbuch die Lieder sangen „Jesus A und O – -” und „Das alte Jahr geht nun zu Ende”, oder „Man wünschet gute Zeiten – -” und „Nun wolle Gott, dass unser G’sang – -“. Einer der ältern Knaben amtete als Vorsänger, ein anderer als Wunschsager. Dieser Wunsch war meistens recht lang und vom Schulmeister oder vom „Heer” verfasst. Jetzt ist dieser Brauch eingegangen, dagegen ziehen die Schulkinder am Neujahrstag zu ihren Paten und Verwandten, um zu gratulieren und eine kleine Gabe einzuheimsen. Es wird dabei folgender Wunsch gesprochen: „I wünscha Ü as guets, glückhaftigs, gsunds, gsägnets, freuderichs Nüjahr, was Ü nutz und guet ist an Seel und Liib und zletscht die ewig Freud und Seligkeit.”
Am Aschermittwoch, als an der „Bschürala”, berussen sich Ledige und Kinder gegenseitig. Natürlich wollen die Mädchen dies nicht geschehen lassen; im Grunde aber möchte doch keine „Wissbrötli” bleiben und so hat sie etwa Kommissionen und Gänge zu machen, bis sie glücklich einem Knaben in die Hände läuft.
An der Fastnacht sodann veranstalten die Ledigen ein „Nidelessen”, Lugmilch genannt, welche Festlichkeit mit Tanz ihren Abschluss findet. Ein ähnliches Nidelessen findet auch im Frühling kurz vor der Alpfahrt im Maiensäss statt. An dasselbe schliessen sich allerlei Spiele im Freien.
Sprichwörter und Redensarten etc.
1. Bim hübscha Wätter nümm d’s Menteli mit, Bim leida chast d’tua wie d’wit.
2. Wenn d’s Wib tuod bucha und bacha soll’ schi dr Ma zum Hus us macha.
3. Wemma vom Schelm redt, so chund’ er.
4. As churz Lied ist gli gsunga.
5. Uf Hitz und Kei, git’s keis bös Gschrei, Aber uf Nässi und Süri git’s Hunger und Türi.
6. Rinnt d’s Wasser über siba Stei, So is’s suber und rei.
7. Niena ist nüt, as wa mas zemmahebt.
8. Mer wend ins Bett, so chönnd d’Lüt hei.
9. Schnit’s vor Martini über da Rhi, so ist dar halb Winter vorbi.
10. A früa Räga und a spata Bättler wärrand nie d’r ganz Tag.
11. A rollenda Stei wasmet nid.
12. Wenn der Bättlerdräck zum Pfäffer würd, so ist er ressar as andera. …
Auf Umwegen auf die Scesaplana.
Es ist ein herrlicher Morgen. Schweigend geht’s den steilen Pfad vom Gasthaus in Schuders hinauf, Richtung Schweizertor. Noch leuchtet der Mond, noch glänzen die Sterne. Aber allmählich wird ihr Schein blasser; leise steigt der junge Tag von den Bergen hernieder. Die Spitzen der Drusenfluh überhauchen sich fahl, erglühen, flammen auf im brennenden Gold der aufgehenden Sonne. Wir sind im Vorderälpli.
Eine Weile schon hatten wir im Wege frische Hirschspuren entdeckt, und nun konnten wir zwei prächtige Exemplare dieses edeln Hochwildes beobachten. Leicht und elegant schritten sie die Alpweiden niederwärts dem Walde zu.
Bald waren wir im Hinterälpli. Anstatt von hier aus durch Partutts den Weg direkt gegen das Schweizertor zu nehmen, wurde beschlossen, der neuen Schutzhütte in der Heidbühlganda und der Schüsshöhle einen Besuch abzustatten. So stiegen wir denn in steilen Kehren hinan gegen den Obersäss Heidbühl. Oberhalb der Alpgemächer, hinter einem riesigen Stein, am Touristenwege, der von der Garschinafurka zum Schweizertor führt, kauert die kleine Hütte. Hier wurde ein Tee bereitet und in „schwellendem Seegras” ein wenig gerastet.
Dann ging es der bekannten roten Markierung nach hinauf zur Schüsshöhle. Dieselbe liegt zirka eine Stunde oberhalb der Hütte, in der westlichen Wand der Drusenfluh. Ihr Eingang ist schmal und niedrig, weitet sich aber bald. Der Gang ist mit feinem Kies bedeckt und verläuft ziemlich horizontal mit mehreren Biegungen über 100 Meter in das Innere der Felswand. Die Decke ist schön gewölbt und weithin von einer sehr regelmässigen Hohlkehle durchzogen. Hinten steigt der Gang plötzlich steil aufwärts. Den Namen hat die Grotte von einem Schuderser, namens Schüss, der sie auf der Gemsjagd entdeckt haben soll.
An Höhlen ist überhaupt das ganze Rhätikongebiet sehr reich; doch sind lange nicht alle zugänglich. Eine solche unzugängliche Höhle findet sich z.B. in der südlichen Wand der Kirchlispitzen, westlich vom Schweizertor. Von dieser Höhle geht folgende Sage: Ein Jäger beobachtete von Partutts aus, wie eine Anzahl Gemsen im Innern dieser Balme verschwanden, und sogleich machte er sich daran, die Stelle zu erklimmen. Fast unüberwindbare Schwierigkeiten stellten sich ihm entgegen, aber die Aussicht auf reichliche Beute trieb ihn vorwärts. Endlich erreichte er die Höhle. Die Gemsen hatten unterdessen jedoch einen andern Ausgang gefunden, weiter oben, in noch ungangbareres Gebiet, wo an eine Verfolgung nicht mehr zu denken war. Unverrichteter Dinge wollte der Jäger seinen Abstieg antreten; allein dieser gestaltete sich noch schwieriger als der Aufstieg. Man weiss nicht, ob der kühne Kletterer von Schwindel ergriffen wurde, ob seine Kräfte versagten, oder ob er einen Unfall erlitt – umsonst versuchte er den Abstieg, er musste wieder in die Höhle zurück. Noch am neunten Tage sollen verzweifelte Hülferufe gehört worden sein; aber Rettung war unmöglich. Wem es einmal gelingt, die Höhle zu ersteigen, wird dort das Steinschlossgewehr und das Gerippe des unglücklichen Jägers finden.
Zur Schutzhütte zurückgekehrt gingen wir den vom S.A.C. neu angelegten Weg hinüber zum Schweizertor. Ein markdurchdringendes Pfeifen drang an unser Ohr, und da und dort verschwanden possierliche Murmeltiere in ihren unterirdischen Behausungen.
Vom Schweizertor ging’s übers Verajöchli zum Lünersee. Auf dieser Wanderung konnten wir ganz in der Nähe ein Rudel von sechs Gemsen beobachten. Fünf davon stiegen auf „ungebahnten Pfaden” hinauf zu den Kirchlispitzen, während ein alter Bock, in mächtigen Sätzen die Geröllhalden traversierend, sich dem Scesaplanamassiv zuwandte.
Am diesseitigen Ufer des Lünersees lud eine schmucke Montafunerin eben eine Anzahl Touristen aus und nahm uns gerne als „Retourfracht” mit. Natürlich ergriffen nun wir die Ruder und arbeiteten uns mit kräftigen Schlägen zur Douglashütte durch. Hier wurde genächtigt.
Am folgenden Morgen rückten wir in aller Frühe der Scesaplana auf den Leib. Es war heute, wie es im Liede heisst, „ein Sonntag hell und klar, ein selten schöner Tag im Jahr”. Fünf Minuten vor Sonnenaufgang war die Spitze erreicht. Welch ein Anblick! Tester hat recht, wenn er sagt: „Alle Gemäldegalerien der Welt, aller Dithyrambenschwung der Dichter ist nur ein Stammeln gegen diese Pracht, diese Erhabenheit!” Da erwacht echte Sonntagsstimmung, da fühlt man den „Tag des Herrn”.
Gegen Osten hin erglühen die Zacken und Firngletscher der Silvrettagruppe im Morgensonnenglanz; über die Albulakette hinaus erblickt man die gewaltige Bernina, und zwischen der Adulagruppe und der Tödikette hin erspäht das Auge sogar die Zermatterberge. Hochwang, Graue Hörner und Kurfirsten werden beinahe übersehen. Über die Appenzellerberge schweift der Blick hinaus auf den Bodensee und die deutschen Lande, und mit den Algäuer-, Lechtaler- und Ötztaleralpen findet das grossartige Panorama endlich seinen Abschluss.
Da das Wetter gar zu verlockend war und uns genügend Zeit zur Verfügung stand, stiegen wir nicht den gewöhnlichen Weg zur Scesaplanahütte des S.A.C. hinab, sondern lenkten unsere Schritte gegen die neue Strassburgerhütte. Dieselbe befindet sich eine halbe Stunde unterhalb des Scesaplanagipfels, am Rande des Brander Ferner. Von der Strassburgerhütte ging’s den Leiberweg hinab in die Zalimalp und dann den Spusagang hinüber gegen den Nenzinger Himmel. Herrlich lagen zu unsern Füssen das sogenannte Hirschbad und das Alpendörfchen St. Rochus. Wir stiegen jedoch nicht so weit hinunter, sondern wandten uns der Kleinen Furka zu. Die ersten lebenden Wesen, die wir wieder auf Schweizergebiet erblickten, waren zwei prachtvolle Grattiere, die in mächtigen Sätzen den sogenannten „Kurzen Gäng” zusprangen. Von der Furka aus wurde abends 6 Uhr die Scesaplanahütte auf Tanuor erreicht. Hier wurden wir als wohlbekannte Gäste von Papa Jost freundlich aufgenommen, und da wir für Montag nichts Bedeutendes vorhatten, entwickelte sich bald ein reges Hüttenleben bis gegen Mitternacht. Morgens um 8 Uhr verliessen wir die herrlich gelegene Hütte und wanderten hinüber nach Colrosa. Anstatt über den vom S.A.C. neu angelegten Weg zum Steinhüttli hinüberzupilgern, wurde beschlossen, dem Girenspitz noch einen Besuch abzustatten. Als Vorposten gewährt dieser Gipfel einen herrlichen Blick auf die Rhätikonkette. Zum letztenmal wurde hier eine Ansprache an den Rucksack gehalten; dann stiegen wir wieder hinunter nach Schuders, wo wir nachmittags 3 Uhr anlangten.
In der Alp-Sennhütte.
Wenn wir von Schuders eine schwache Stunde aufwärts steigen, so kommen wir in das Gebiet der Alpweiden. Eine Alp reiht sich an die andere den ganzen Rhätikon entlang. Und nun wollen wir einmal Einkehr halten in einer Sennhütte und die Hirten und Sennen bei ihrer Arbeit beobachten.
Früh morgens um 3 Uhr müssen die Hirten hinaus aus ihrem „Seegras”, die Kühe zu sammeln. Sind alle die 100 und mehr Stück im grossen Schermen beisammen, so wird mit Melken begonnen. Küher, Senn, Zusenn und Batzger haben sich in das Geschäft des Melkens zu teilen. Jeder hatte am Alpfahrttag durchs Los seine Kühe zugeteilt erhalten. Selbstverständlich ist es keine Kleinigkeit, 20 bis 25 Kühe richtig zu melken. Für den Bauer aber ist es von grösster Wichtigkeit, dass seine Kühe einem tüchtigen Melker zufallen; denn davon hängt zu einem grossen Teil der Gesundheitszustand der Kühe, sowie deren Milchertrag ab. Sämtliche Kühe eines Bauern werden zusammen gemolken, dann die Milch vom Schreiber gewogen oder gemessen und in die gemeinsamen grossen Holzgebsen geschüttet.
Nach dem Melken wird das Frühstück eingenommen, bestehend aus Milch und Brot oder einem Rahmmus. Hierauf treiben Küher und Kühbub ihre Herde hinaus auf die Tageweide, während Senn und Zusenn, Batzger und Schreiber mit Sennen beginnen.
Sorgfältig entrahmt der Senn die duftende Milch; den Rahm schüttet er ins Butterfass, die bläuliche Milch in den Käsekessel. Nun wird das Butterfass, welches inwendig in durchgehende Kammern abgeteilt ist, in Rotation versetzt. In zirka einer Stunde teilt sich der Rahm in Butter und Ankmilch (Schlegmilch). Vorsichtig lässt der Zusenn die süsse Ankmilch ablaufen, nimmt die würzige Butter heraus, knetet sie in frischem Wasser tüchtig aus und formt sie zu Ballen.
Unterdessen hat man der leicht erwärmten Milch im grossen Kessel etwas Lab beigefügt, infolgedessen sie sich in einen leberdicken Quark verwandelt. Diesen Quark zerteilt der Senn mit dem „Käserührer” zu kleinen Flocken, die sich auf dem Grunde des Kessels sammeln. Sorgfältig werden die Flöckchen dann zu einem Klumpen „zusammengetrieben” und mit einem Tuche herausgehoben. Nun bringt der Batzger den „Schgapp” herbei, eine viereckige Form, in welche die blendendweisse „Pulla” hineingelegt, fein „zermiglet”, gesalzen und gepresst wird.
Die zurückbleibende gelbliche Sirte wird noch bis zum Siedepunkt erwärmt und dann mit „Sauer” vermischt. Sofort scheidet sich oben der Ziger aus, der in eine hohe, runde Form gebracht und auf die „Brügi” gestellt wird. Die zurückbleibende gelbgrüne Schotte wird noch als Schweinefutter verwendet. Der Ziger ist nach einigen Tagen geniessbar, während der Käse unter sorgfältiger Behandlung erst ausreifen muss.
Nach Verrichtung dieser Geschäfte wird das Mittagessen bereitet, bestehend aus Milchreis, Tatsch oder Sufi. Letztere erhält man durch Einfällen von eben gewonnenem Ziger in frischen Rahm.
Die Verteilung der Milchprodukte an die Bauern erfolgt im Herbst nach Entladung der Alp auf Grund der vom Schreiber geführten Milchkontrolle.
Wie vor hundert Jahren die Milchprodukte verteilt wurden, lesen wir im „Neuen Sammler” von 1805:
„Acht Tage nach der Alpfahrt wird gemessen, d.h. von den Kühen eines jeden Besitzers wird zu gleicher Zeit eine Kuh gemolken – diese heissen die Einer; dann folgen die Zweier, Dreier etc. Aber der Eigentümer darf dies Melken nicht selbst vornehmen, sondern muss es durch einen andern geschehen lassen, der nicht näher als im dritten Grade verwandt sein darf. Dies heisst z’Einer oder z’Wechsel melken. Am Abend darauf wird wieder in gleicher Ordnung gemolken, nur mit dem Unterschied, dass jeder Eigentümer dies Geschäft an seinen eigenen Kühen verrichtet.
Von diesen beiden Malen wird die Milch einer jeden Kuh besonders gewogen und dem Eigentümer angeschrieben.
Zwei Krinnen à 48 Loth werden für eine Mass und zwei Mass für einen Binner gerechnet. (Es gibt halbe, ganze, zwei- und vierfache Binner; 1 Binner hat 24 Löffel; 12 Löffel sind also 1 Mass.) Nach dem, was jeder an diesem Tage misst, wird sein Anteil an den Molken und an den Alpkosten während des ganzen Sommers bestimmt. Doch mit dem folgenden Unterschied: Es geschieht oft, dass Kühe im Sommer an Milch abnehmen; alsdann misst man alle Wochen am gleichen Tage ihre Milch, und gibt sie dann keinen überlaufenden Messlöffel voll, so heisst es, die Kuh habe gezehrt (abgenommen). Vermindert sich ihre Milch schon im August, so ist es die hohe Zehrung, und der Eigentümer erhält zwar seine Molken nach dem Mass des ersten Messtages, allein er muss für jede Woche seit der Zehrung 24 Blutzger bezahlen und 12 Blutzger, wenn das Zehren erst im September anfing.
Beim Messen wird der Preis der Milch von jedem Senntum bestimmt. Wer 6 Löffel eigene Milch hat, darf 6 Löffel von andern kaufen, um 1/2 Binner zu haben, aber nicht mehr, damit es keine Verwirrung gebe. Hingegen muss das Senntum dem, der weniger hat als 6 Löffel, sie um den taxierten Preis abkaufen, wenn er keinen andern Käufer fände. Zur Nahrung der Hirten u. s. w. wird nach dem Messen von jedem gemessenen Binner etwas abgezogen, 1/4 oder 1/6.
Für jedes Senntum der Kühalpen sind zwei Alpmeister (Brotgschauer) gewählt, welche in der Aufsicht abwechseln; bei den anderen Gemeinden ist sie den Gemeinds-Cavigen anvertraut, die bei wichtigen Fällen die Gemeinde befragen.
Unsere Sennen führen ihre Buchhaltung auf eine kunstlose und doch deutliche Weise. Jeder Alpgenosse hat seine Alpscheite (ein Stückchen Holz), auf welche man die gemessenen Binner mit eingeschnittenen Kerben, die verkaufte Milch mit einem Tupf, die gekaufte mit einem Kritz bemerkt. Die andere Seite dient dem Sennen, die dem Eigentümer à conto gegebene Molken, deren keiner nach dem Verhältnis mehr erhält als der andere, anzuzeichnen und späterhin mit römischer Zahl, was jede Scheite an Alplohn schuldig ist. Der Senn bewahrt die Scheiten, an einer Schnur gereiht, und übergibt sie am Ende der Alpzeit den Alpmeistern. Im März wird dann Rechnung gehalten; jeder Teilhaber zahlt dem Sennen seinen Teil am Lohn, und der Senn quittiert ihm, indem er ihm seine Alpscheite zurückgibt. Das Salz zum Mieten (Lecken) wird aus verkaufter Butter bezahlt.
Das Teilen am Ende der Alpzeit geschieht nach einem gehaltenen Mehren. Zuerst geht der Alpmeister in die Alp und hilft dem Sennen ordnen, damit jeder Eigentümer in Menge und Güte der Molken gehalten werde genau wie der andere. Dann folgen alle Teilhaber nach in die Alp. So viel Binner gemessen wurden, so viel Lose von Schindelstücken werden gemacht, mit dem Hauszeichen des Eigentümers versehen, in einen Sack getan und geschüttelt. Nachdem nun der Senn zwei Käse, zusammen von 15 – 18 Krinnen, vor die Kellertüre gestellt und der Zusenn einen Ziger darauf gelegt hat, langt ein Bub eines der Lose heraus und so fort, bis alles geteilt ist. Je nach dem Jahrgang trifft es 8 – 12 Krinnen Schmalz auf jeden Binner, 2 Käse à 7 – 8 Krinnen und einen Ziger von 6 – 8 Krinnen. Jeder Senn bestrebt sich, mehr auf den Binner zu geben als andere, denn wer am wenigsten gibt, wird von andern verspottet.”
Es ist 3 Uhr nachmittags. Die Kühe nähern sich langsam dem Stafel, um wieder gemolken zu werden. Nach dem Melken werden sie abermals hinausgetrieben, diesmal aber auf die naheliegenden Abendweiden.
Am Abend nach getaner Arbeit setzen sich die Älpler in der Hütte um ein loderndes Herdfeuer und erzählen sich allerlei Geschichten, z.B.:
Der Haldenjoli.
Vom Haldenjoli erzählt der Senn: Es war im September, kurz vor der Alpentladung. Ruhig schliefen wir auf unserem Heulager, als plötzlich um Mitternacht ein mächtiger Windstoss die Hütte erzittern machte. Jäh fuhren wir auf. Oberhalb der Hütte erhob sich aus Sturm- und Windesrauschen das vielstimmige Geläute der Viehherde und das markdurchdringende Rufen einer Männerstimme. Wir schauten hinaus. Kein lebendes Wesen war zu sehen, nur grosse Wolkenschatten zogen über die mondhelle Weide. Aber von neuem erklang von der Halde herüber die grässliche Stimme des nächtlichen Kühers, gellend, ohrzerreissend, wie der Wehruf eines Verzweifelnden. Immer weiter entfernte sich der unheimliche Hirte mit seiner Herde. Noch einmal ertönte es vom Walde herauf „Hoi, hoi, hoo!” Dann verstummte allmählich das Schellengeläute. Undeutlich und schwach wurde auch der Geisterruf des Kühers und verstummte schliesslich ebenfalls in weiter Ferne. In den Felsen aber fing der Sturmwind an zu heulen, und am Morgen lag Schnee bis weit unter die Alpengemächer hinab.
Die Alpmutter.
Ein Jäger ging im Spätherbst an einer Hütte der Alp Drusen vorbei und hörte in derselben ein Geräusch und Getümmel, als ob es Hochsommer und die Sennen vollauf beschäftigt wären. Die Neugierde lockte den Weidmann, er ging hin, guckte durch eine Kluft in die Alphütte hinein und gewahrte in derselben die leibhaftige Alpmutter. Es war ein altes, buckliges Weiblein, das, am Herde stehend, eifrig mit Kochen beschäftigt war. Rings um den Herd und um die bucklige Köchin herum tanzte eine Schar kleiner Tiere: das eine ein Salzbüchslein, das andere eine Kochkelle, das dritte einen Seihwisch, alle etwelches Kochgerät in den Vorderpfoten haltend, ausgenommen eines, das leer tanzte und nichts in den Pfoten trug. Zu diesem kleinen Taugenichts wandte sich plötzlich das Weibchen und knurrte: „Du, Hanschasperli, choz mer Schmalz!” und siehe da, Hanschasperli erbrach Schmalz in Hülle und Fülle.
Die Puppe in der Drusen-Alp.
Unter dem Stafel der Alp Drusen steht ein grosser Stein, und von Stafel und Stein geht eine schauerliche Sage:
In dieser Alp Drusen waren einmal ein paar mutwillige Knechte und ein ruchloser Senn. Die hatten wenig zu arbeiten, und einer von ihnen fiel im Übermute auf den frevelhaften Gedanken, von „Blätzen” eine Puppe zu machen, lebensgross und menschenähnlich. Dieser Puppe legten sie eine „Juppe” mit kurzem „Gstältli” an, ein „Tschööpli” mit „Zülli” und „Häftli”, ein Paar Schuhe mit „Ringgen” und ein „Flor-Bödeli” mit „Chrüseli”.
Die so angekleidete Puppe wurde von den Alpknechten herumgetragen, auf eine Bank gesetzt, ihr Mus und Rahm eingestrichen, dann Fragen lästerlicher Art an sie gestellt u.a. m. bis der Senn noch auf den gottlosen Gedanken kam, die Puppe zu taufen.
Mit „Plumpen” (grösste Sorte Glocken, die den Kühen umgehängt werden) wurde zu dieser Taufe geläutet. Auf einen Scheiterstock wurde eine „Gebse” gestellt: Das waren Taufstein und Taufbecken. Die Knechte waren die „Götteti” und der Senn selber der „Pfarrer”, der die sündhafte Taufhandlung vollzog.
Eben waren sie daran, an der Puppe die Taufe zu vollziehen, als ein armes, altes Weib in die Hütte trat und um eine Gabe bat. „Wir haben schon eine Alte, die wir futtern müssen”, war die Antwort des herzlosen Sennen. „Die soll essen.” „Gut, ich gehe”, rief das Weib, „und die da soll essen und fressen.” „Ja, essen und fressen soll sie”, rief der Senn höhnisch dem Weibe entgegen und strich mit diesen Worten der Puppe einen Löffel voll Rahm ins Maul.
Da ergriff sie ein grauenhaftes Wunder: Im Augenblicke, als der Ruchlose in den drei höchsten Namen die Puppe mit Wasser begoss, schlug diese die Augen auf und fing an zu reden. „Ja, essen und fressen, essen und fressen will ich”, rief sie. Und schrecklich starrte sie den Senn und die Knechte mit grässlich leuchtenden Augen an. Dann herrschte sie weiter: „Machet, dass ihr so schnell als möglich mit Vieh und Habe fortkommt, der Senn aber muss hier bleiben. Und lasset euch nicht gelüsten, zurückzuschauen, bis ihr über das dritte Tobel gekommen seid.” Der entsetzlichen Puppe Willen wurde erfüllt – der Senn blieb zurück.
Als sie aber vom dritten Tobel aus nach dem Stafel zurückschauten, breitete die Puppe eben die Haut des Sennen, welche sie dem Frevler bei lebendigem Leibe abgezogen hatte, auf dem grossen Steine beim Stafel aus.
(Quelle: Jahrbuch des S. A. C. 1907 von Math. Thöny, Sektion Prättigau)